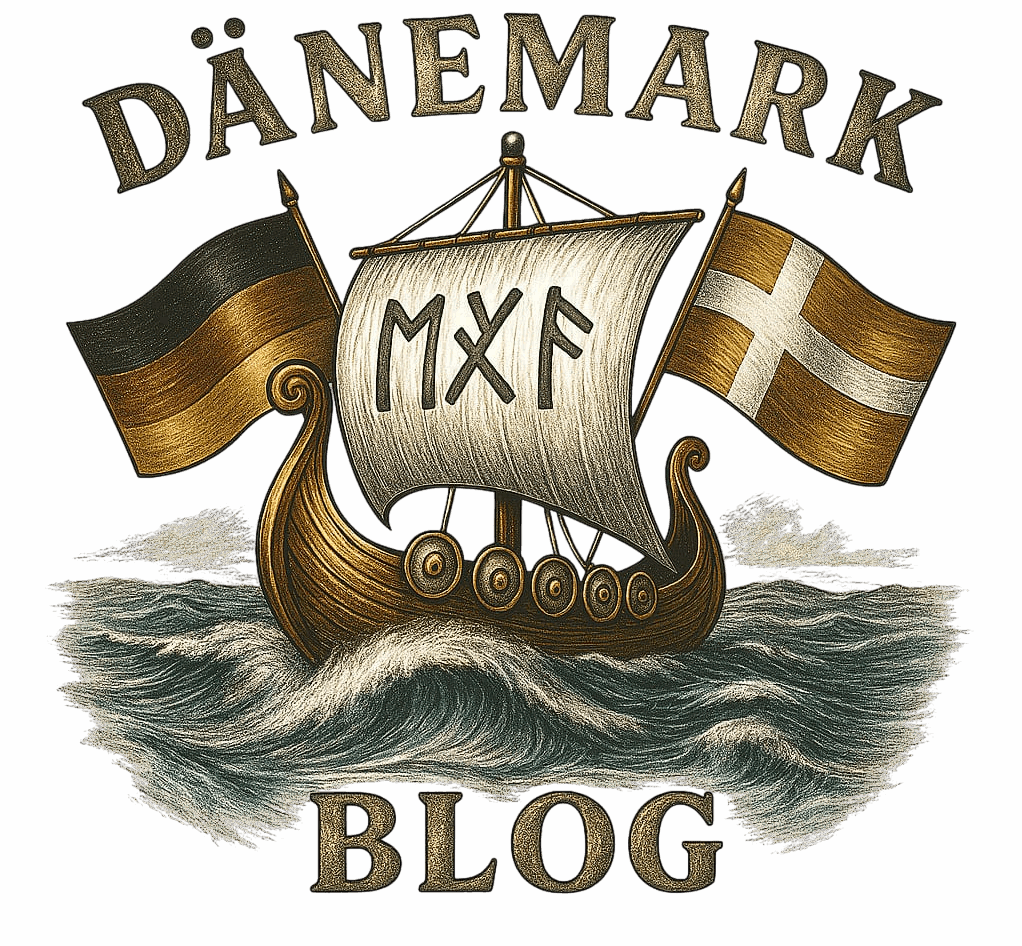Reichsauflösung, Spätmittelalter
Die Niederlage von Bornhöved schlug Expansionsgedanken aus dem Kopf Waldemars II. Statt Reichserweiterung betrieb er nun die Sicherung seiner herrschaftlichen Macht, indem er Abkommen mit politischen Gegnern traf. Reval wurde in das Erzbistum von Lund eingegliedert. 1232 wurde Erik IV. Mitkönig, nachdem sein älterer Bruder Waldemar starb. Durch die Heirat Herzog Abels mit der schauenburgischen Grafentochter Mechthild von Holstein sollte ein Frieden zwischen Schleswig und Holstein hergestellt werden. 1231 erschien das „Landbuch des Königs Waldemar“, welches dienlich bei Steuererhebungen sein sollte. Es benötigte Jahrzehnte, um vollendet zu werden und gewährt heute einen guten Einblick in das Finanz- und Steuersystem des Mittelalters.
Die Reichseinheit, die unter Waldemar I. entstanden war, währt aber nicht ewig. Vor seinem Tod hatte Waldemar II. Grenzprovinzen seinen Söhnen überlassen. Abel wurde Herzog von Süderjütland, Christoph wurde Herzog von Lolland-Falster und zwei außerhalb der Ehe gezeugte Söhne, Niels und Knut, bekamen Halland und Blekinge. Obwohl jene Lehen gar nicht als erblicher Besitz vorgesehen waren, sorgen sie für Unruhe hinsichtlich der Reichseinheit. König Erik IV. sah sich in vielen Angelegenheiten den Brüdern gegenübergestellt, meist Herzog Abel. Die Kirche blieb von folgenden Auseinandersetzungen nicht verschont und drohte sogar mit Bann. Als Erik IV. Steuerabgaben für jeden im Einsatz befindlichen Pflug Dänemarks forderte, entflammten Unruhen und Aufstände im Volk. Der König (nun unter dem Namen „Erik Plovpenning“ bekannt) war gezwungen zu fliehen. Nach Angriffen von Seiten Herzog Abels zog Erik IV. 1250 nach Schleswig, um den Herzog im Gefecht zu bezwingen. Obwohl der König obsiegte, wurde er nach Verhandlungen auf Geheiß des schleswigschen Herzogs bei Missunde ermordet.
Nach dem Tod Eriks IV. 1250 ließ sich Herzog Abel auf einem Thing zu Viborg zum König wählen und wurde daraufhin gekrönt. Während seiner Herrschaft von 1250 bis 1252 gewährte er dänischen Handelsleuten, aber vor allem ausländischen Kaufleuten, viele Privilegien. Diese handelsfreundliche Politik erwies sich als kritisch im wirtschaftlichen Machtkampf gegen die stets wachsende deutsche Hanse. Um das Land noch mehr zu zentralisieren und somit „verwaltbarer“ zu machen, wurde die „Abel-Christoffersche Verordnung“ erlassen, die Christoph I. die Pflicht der Weiterführung des Reichs zusprach. Aufgrund von drei Kriegen an drei Fronten fiel ihm diese Aufgabe schwer. Als Abel während eines Feldzugs gegen die Friesen ermordet wurde und sein ältester Sohn sich in Gefangenschaft des Erzbischofs von Köln befand, wurde Christoph zum König erhoben. Norwegen und Schweden drohten das Reich anzugreifen, während Abels Witwe Mechthild von Holstein sich darum bemühte, ihren Söhnen die Krone zu sichern. Den Norden beschwichtigte Christoph I. mit Schadenersatz. Indem der König adeligen Bestrebungen nach Macht nachgab, erreichte er, dass der königliche Hof das Obergericht des dänischen Reichs wurde. Streit entbrannte zwischen Kirche und König, als Erzbischof Jakob Erlandsen versuchte, alle dänischen und weltlichen Untergebenen der Kirche unter Kirchenjurisdiktion zu bringen. Als sich der König dem entgegenstellte, blieb der Erzbischof 1252 dem Hof fern. In Vejle wurde 1256 während einer Kirchenversammlung ein Interdikt für den Fall beschlossen, dass Bischöfe in königliche Haft genommen werden. Erlandsen verlor seine Privilegien bei Hof, und wurde 1259 vorübergehend festgesetzt. Da Christoph I. in diesem Jahr starb, ließ seine Witwe Erlandsen frei, woraufhin er seinen Widerstand aus Rom und dem benachbarten Ausland fortsetzte.