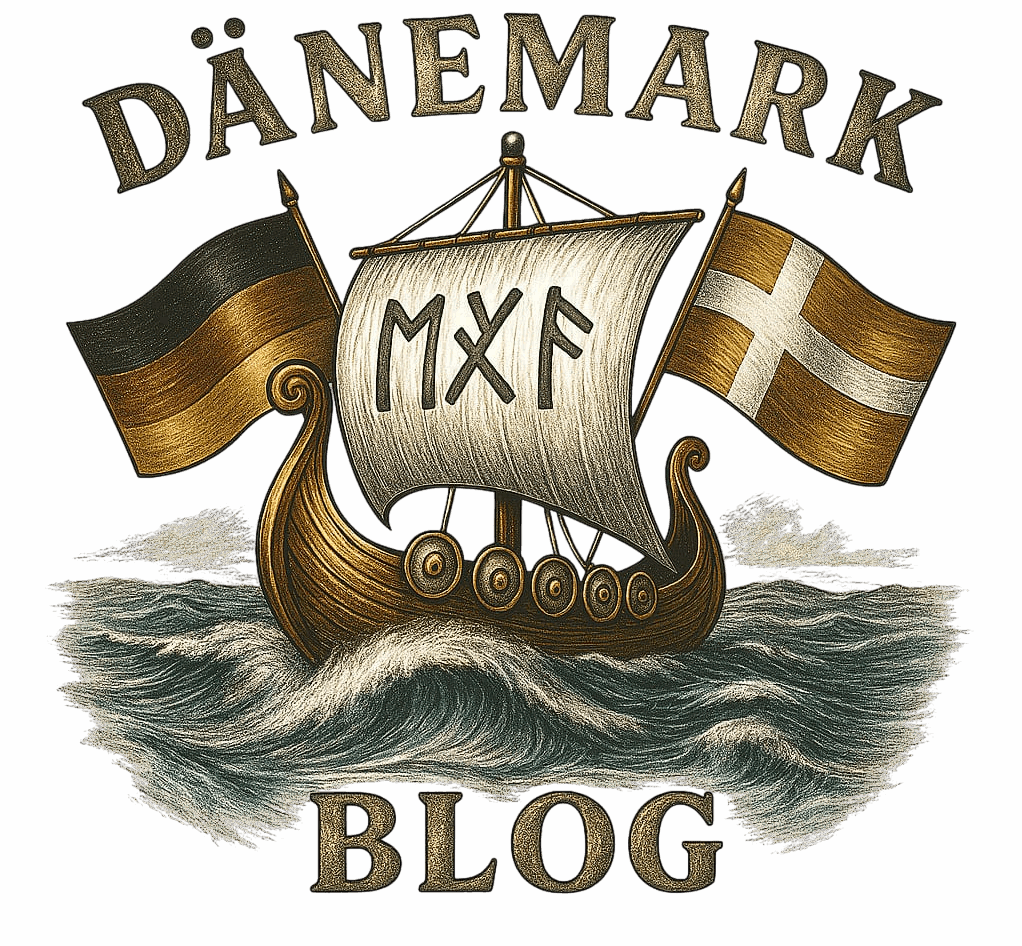Hochmittelalter
Dom zu Lund, Chorraum mit Apsis
Ab der Regentschaft Knut des Heiligen (außerehelicher Sohn von Sven Estridsson (1080–1086)), stieg der Wohlstand der dänischen Krone, was an der engen Verbindung zwischen Königshaus und Kirche lag. Ein Beispiel ist die Schenkungsurkunde für den Domkirche in Lund. Das Geld für den Kirchenbau stammte größtenteils von Bußen für Landfriedensbruch und den Bruch der Ledingspflicht – Mittel, die zum Teil dem König zugedacht waren (die Leding war die Pflicht jedes Freien zur Heerfolge). Es war vorgesehen, dass im Kriegsfall jeder Kreis Dänemarks dem König eine bestimmte Anzahl von Schiffen samt Besatzung stellen musste. Wer dieser Pflicht nicht nachkam, machte sich strafbar und musste in der Regel Grundbesitz abtreten.[40]
Knut IV. versuchte die königliche Macht im Lande zu stärken, wozu er wiederholt in die überlieferte Rechtsordnung eingriff. Dies führte zu Widerstand, und während eines Volksaufstands wurde er 1086 in der Sankt Albans-Kirche zu Odense erschlagen, später jedoch heiliggesprochen.
Königtum und Kirche versuchten gemeinsam zu wachsen und die Macht im Lande zu zentralisieren. 1104 wurde hierzu das Erzbistum Lund gründet, dem der gesamte Norden unterstand. Im selben Jahr änderte König Niels eine Reihe von Hofämtern, wodurch bestimmte Funktionen aufgewertet wurden. Mundschenke, beispielsweise, wurden zu Drosten befördert und verwalteten ab sofort Reichsangelegenheiten; Marschälle waren zunehmend für die Verwaltung des Militärs zuständig. Auch die Zahl königlicher Amtspersonen nahm in dieser Zeit beträchtlich zu. Widerstand gegen diese Konzentration von Macht schlugen König und Kirche gemeinsam nieder. In den letzten Jahren der Herrschaft von König Niels wurde außerdem versucht, den Zölibat mit Gewalt durchzusetzen. Dieser Konflikt führte zu einer gesetzlichen Besonderheit, nämlich dem privilegium fori, d. h. der Unabhängigkeit der Kirche von Thinggerichten.
Zwischen Zersplitterung und Großmachtzeit
Als Knud Lavard, Herzog Süderjütlands die Wendenstämme im Westen als Reichslehen erhielt, wurde er als Anwärter auf den dänischen Thron angesehen, und somit zum Konkurrenten von Prinz Magnus. Bei einer Zusammenkunft der Kontrahenten bei Ringsted wurde Knud Lavard am 7. Januar 1131 ermordet. Infolgedessen nahm sein Halbbruder Erik II. den Kampf gegen Magnus auf. Dies glückte ihm dank der erhaltenen Hilfe der seeländischen Adeligen der Hvide. 1134 fand die Schlacht bei Fodevig in Schonen statt, in welcher Prinz Magnus und fünf Bischöfe fielen. König Niels überlebte das Gefecht, wurde jedoch kurz danach in Schleswig von Gildebrüdern erschlagen.
Noch 1134 wurde Erik II. zum König gekrönt. Während seiner Herrschaft widmete Erik der Heiligsprechung seines ermordeten Bruders viel Mühe. Der Erzbischof von Lund, Asker, schien dem Wunsch nachkommen zu wollen, allerdings war sein Nachfolger Eskil diesem Anliegen nicht so wohlgesinnt. Aufflammende Bürgerkriege lenkten ebenfalls von diesem Vorhaben ab. Um 1157 unterlagen Waldemar, dem Sohn Knud Lavards, alle Gegner im Thronfolgestreit. Als Alleinherrscher erhielt König Waldemar I. die päpstliche Aufmerksamkeit und Gunst, die nötig war, um Knud Lavard heiligsprechen zu lassen. In einer Doppelzeremonie im Jahr 1170 wurde der längst ermordete Herzog kanonisiert und Waldemars siebenjähriger Sohn, Knut VI., von Erzbischof Eskil zum König gekrönt.
Im Anschluss war das Verhältnis zwischen Erzbischof und König oft zwieträchtig. Beide Parteien standen einander im Laufe der folgenden Jahre mehrmals gegenüber. König Waldemar leistete dem deutschen Kaiser Friedrich Barbarossa 1162 die Lehnshuldigung und versprach diesem somit seine Treue. Angesichts heftiger Auseinandersetzungen mit dem dänischen König ging Erzbischof Eskil 1177 ins Exil, worauf Bischof Absalon, ein Mitglied des Hvide-Geschlechts, dessen führende geistliche Position übernahm. Während dieser Zeit genoss König Waldemar gute Verhältnisse zum Papst Alexander III. In Betracht der päpstlichen Gunst versöhnte sich Erzbischof Eskil mit dem König und kehrte nach einigen Jahren zurück. Zusammen ordneten König und Kirche die Verzierung dänischer Kirchen und die Errichtung vieler Klöster an. Der Zisterzienserorden wurde besonders gefördert und besaß bald viele Niederlassungen und Einfluss im Land.
Infolge etlicher dänischer Kreuzzugsunterfangen gegen die Wenden wurde 1168 das slawische Kulturzentrum Arkona auf Rügen erobert. Dies wurde von den Dänen als größter Vergeltungsschlag gegen viele Jahre slawischer Piratenzüge und Plünderungen angesehen. Der Sieg führte zu einem einenden Gemeinsamkeitsgefühl unter dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Volk. Als Rügen in das Bistum Roskilde eingegliedert wurde, führt das zu massiven Aufständen gegen die dänische Herrschaft von Seiten der Wenden. In den darauffolgenden Kriegen erlangte Dänemark Besitz von Estland. 1219 wurde die Schlacht von Lyndanisse dazu genutzt, die göttliche Zuneigung gegenüber Dänemark zu belegen. Auf die Gebete des Erzbischofs Andreas Sunesen soll Gott gehört und den Dänen den Sieg geschenkt haben. Durch dieses sagenumwobene Ereignis wuchs das Vertrauen des Volkes gegenüber dem König und einer starken Kirche.
Während der frühen Jahre des 12. Jahrhunderts errang Dänemark weitere militärische Erfolge. Die Grafschaft Holstein, einst unter Herrschaft der Schauenburger, wurde von Dänemark 1200/1201 erobert. 1202 wurde Lübeck ebenfalls unter dänische Kontrolle gebracht, behielt allerdings sehr viel Eigenständigkeit in vielen geschäftlichen und politischen Bereichen. Diese Selbständigkeit fand sich nach Lübecks Vorbild in vielen Verfassungen späterer dänischer Städte wieder.
Waldemarzeit
Nach gewaltsamen und erfolgreichen Siegen über das aufständische Volk, welches gegen das zentralistisch veranlagte, großmächtige Königtum und eine ebenfalls zentralisierte, gewaltige Kirche gefochten hatte, gedieh das Waldemargeschlecht. Eine Waldemar-Dynastie entstand, deren Macht und Einfluss sich mit Gunst und Willen Gottes rechtfertigte. Die als „Valdemarernes Storhedstid“ (Großmachtzeit der Waldemardynastie) bezeichnete Zeit bezieht sich auf die frühen Jahre des 12. Jahrhunderts, in welchen Dänemark eine führende Handelsmacht war und im eigenen Land eine produktive Landwirtschaft gedieh. Eine neue dänische Adelsschicht bildete sich, die Steuerfreiheit genoss, sich dafür jedoch unausweichlich zum Kriegsdienst verpflichtete und völlig mit dem Militärdienst befasst war. Holzbauten verschwanden zumeist und wurden durch Stein ersetzt, Kirchen nahmen den romanischen Stil an. Eine Großzahl junger Dänen besuchte in dieser Zeit angesehene Universitäten des mittelalterlichen Europa. Ein Drang nach Bildung und Gelehrtheit flammte auf, indem Erzbischof Andreas Sunesen dem Volk Mut zusprach, Latein ohne klassische Texte zu lernen.
1202 wurde Waldemar II., jüngerer Sohn von Waldemar I., zum König gekrönt, was die Dynastie festigte. Dann allerdings wurde 1223 Waldemar II. mit seinem Sohn Waldemar während der Jagd durch den Grafen von Schwerin gefangen und erst 1225 nach der Schlacht bei Mölln und Zahlung eines hohen Lösegelds freigelassen. Infolgedessen büßte Dänemark seine norddeutschen Territorien ein und gewann sie auch nach der Niederlage in der Schlacht von Bornhöved im Jahr 1227 nicht wieder.Hochmittelalter
Dom zu Lund, Chorraum mit Apsis
Ab der Regentschaft Knut des Heiligen (außerehelicher Sohn von Sven Estridsson (1080–1086)), stieg der Wohlstand der dänischen Krone, was an der engen Verbindung zwischen Königshaus und Kirche lag. Ein Beispiel ist die Schenkungsurkunde für den Domkirche in Lund. Das Geld für den Kirchenbau stammte größtenteils von Bußen für Landfriedensbruch und den Bruch der Ledingspflicht – Mittel, die zum Teil dem König zugedacht waren (die Leding war die Pflicht jedes Freien zur Heerfolge). Es war vorgesehen, dass im Kriegsfall jeder Kreis Dänemarks dem König eine bestimmte Anzahl von Schiffen samt Besatzung stellen musste. Wer dieser Pflicht nicht nachkam, machte sich strafbar und musste in der Regel Grundbesitz abtreten.[40]
Knut IV. versuchte die königliche Macht im Lande zu stärken, wozu er wiederholt in die überlieferte Rechtsordnung eingriff. Dies führte zu Widerstand, und während eines Volksaufstands wurde er 1086 in der Sankt Albans-Kirche zu Odense erschlagen, später jedoch heiliggesprochen.
Königtum und Kirche versuchten gemeinsam zu wachsen und die Macht im Lande zu zentralisieren. 1104 wurde hierzu das Erzbistum Lund gründet, dem der gesamte Norden unterstand. Im selben Jahr änderte König Niels eine Reihe von Hofämtern, wodurch bestimmte Funktionen aufgewertet wurden. Mundschenke, beispielsweise, wurden zu Drosten befördert und verwalteten ab sofort Reichsangelegenheiten; Marschälle waren zunehmend für die Verwaltung des Militärs zuständig. Auch die Zahl königlicher Amtspersonen nahm in dieser Zeit beträchtlich zu. Widerstand gegen diese Konzentration von Macht schlugen König und Kirche gemeinsam nieder. In den letzten Jahren der Herrschaft von König Niels wurde außerdem versucht, den Zölibat mit Gewalt durchzusetzen. Dieser Konflikt führte zu einer gesetzlichen Besonderheit, nämlich dem privilegium fori, d. h. der Unabhängigkeit der Kirche von Thinggerichten.
Zwischen Zersplitterung und Großmachtzeit
Als Knud Lavard, Herzog Süderjütlands die Wendenstämme im Westen als Reichslehen erhielt, wurde er als Anwärter auf den dänischen Thron angesehen, und somit zum Konkurrenten von Prinz Magnus. Bei einer Zusammenkunft der Kontrahenten bei Ringsted wurde Knud Lavard am 7. Januar 1131 ermordet. Infolgedessen nahm sein Halbbruder Erik II. den Kampf gegen Magnus auf. Dies glückte ihm dank der erhaltenen Hilfe der seeländischen Adeligen der Hvide. 1134 fand die Schlacht bei Fodevig in Schonen statt, in welcher Prinz Magnus und fünf Bischöfe fielen. König Niels überlebte das Gefecht, wurde jedoch kurz danach in Schleswig von Gildebrüdern erschlagen.
Noch 1134 wurde Erik II. zum König gekrönt. Während seiner Herrschaft widmete Erik der Heiligsprechung seines ermordeten Bruders viel Mühe. Der Erzbischof von Lund, Asker, schien dem Wunsch nachkommen zu wollen, allerdings war sein Nachfolger Eskil diesem Anliegen nicht so wohlgesinnt. Aufflammende Bürgerkriege lenkten ebenfalls von diesem Vorhaben ab. Um 1157 unterlagen Waldemar, dem Sohn Knud Lavards, alle Gegner im Thronfolgestreit. Als Alleinherrscher erhielt König Waldemar I. die päpstliche Aufmerksamkeit und Gunst, die nötig war, um Knud Lavard heiligsprechen zu lassen. In einer Doppelzeremonie im Jahr 1170 wurde der längst ermordete Herzog kanonisiert und Waldemars siebenjähriger Sohn, Knut VI., von Erzbischof Eskil zum König gekrönt.
Im Anschluss war das Verhältnis zwischen Erzbischof und König oft zwieträchtig. Beide Parteien standen einander im Laufe der folgenden Jahre mehrmals gegenüber. König Waldemar leistete dem deutschen Kaiser Friedrich Barbarossa 1162 die Lehnshuldigung und versprach diesem somit seine Treue. Angesichts heftiger Auseinandersetzungen mit dem dänischen König ging Erzbischof Eskil 1177 ins Exil, worauf Bischof Absalon, ein Mitglied des Hvide-Geschlechts, dessen führende geistliche Position übernahm. Während dieser Zeit genoss König Waldemar gute Verhältnisse zum Papst Alexander III. In Betracht der päpstlichen Gunst versöhnte sich Erzbischof Eskil mit dem König und kehrte nach einigen Jahren zurück. Zusammen ordneten König und Kirche die Verzierung dänischer Kirchen und die Errichtung vieler Klöster an. Der Zisterzienserorden wurde besonders gefördert und besaß bald viele Niederlassungen und Einfluss im Land.
Infolge etlicher dänischer Kreuzzugsunterfangen gegen die Wenden wurde 1168 das slawische Kulturzentrum Arkona auf Rügen erobert. Dies wurde von den Dänen als größter Vergeltungsschlag gegen viele Jahre slawischer Piratenzüge und Plünderungen angesehen. Der Sieg führte zu einem einenden Gemeinsamkeitsgefühl unter dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Volk. Als Rügen in das Bistum Roskilde eingegliedert wurde, führt das zu massiven Aufständen gegen die dänische Herrschaft von Seiten der Wenden. In den darauffolgenden Kriegen erlangte Dänemark Besitz von Estland. 1219 wurde die Schlacht von Lyndanisse dazu genutzt, die göttliche Zuneigung gegenüber Dänemark zu belegen. Auf die Gebete des Erzbischofs Andreas Sunesen soll Gott gehört und den Dänen den Sieg geschenkt haben. Durch dieses sagenumwobene Ereignis wuchs das Vertrauen des Volkes gegenüber dem König und einer starken Kirche.
Während der frühen Jahre des 12. Jahrhunderts errang Dänemark weitere militärische Erfolge. Die Grafschaft Holstein, einst unter Herrschaft der Schauenburger, wurde von Dänemark 1200/1201 erobert. 1202 wurde Lübeck ebenfalls unter dänische Kontrolle gebracht, behielt allerdings sehr viel Eigenständigkeit in vielen geschäftlichen und politischen Bereichen. Diese Selbständigkeit fand sich nach Lübecks Vorbild in vielen Verfassungen späterer dänischer Städte wieder.
Waldemarzeit
Nach gewaltsamen und erfolgreichen Siegen über das aufständische Volk, welches gegen das zentralistisch veranlagte, großmächtige Königtum und eine ebenfalls zentralisierte, gewaltige Kirche gefochten hatte, gedieh das Waldemargeschlecht. Eine Waldemar-Dynastie entstand, deren Macht und Einfluss sich mit Gunst und Willen Gottes rechtfertigte. Die als „Valdemarernes Storhedstid“ (Großmachtzeit der Waldemardynastie) bezeichnete Zeit bezieht sich auf die frühen Jahre des 12. Jahrhunderts, in welchen Dänemark eine führende Handelsmacht war und im eigenen Land eine produktive Landwirtschaft gedieh. Eine neue dänische Adelsschicht bildete sich, die Steuerfreiheit genoss, sich dafür jedoch unausweichlich zum Kriegsdienst verpflichtete und völlig mit dem Militärdienst befasst war. Holzbauten verschwanden zumeist und wurden durch Stein ersetzt, Kirchen nahmen den romanischen Stil an. Eine Großzahl junger Dänen besuchte in dieser Zeit angesehene Universitäten des mittelalterlichen Europa. Ein Drang nach Bildung und Gelehrtheit flammte auf, indem Erzbischof Andreas Sunesen dem Volk Mut zusprach, Latein ohne klassische Texte zu lernen.
1202 wurde Waldemar II., jüngerer Sohn von Waldemar I., zum König gekrönt, was die Dynastie festigte. Dann allerdings wurde 1223 Waldemar II. mit seinem Sohn Waldemar während der Jagd durch den Grafen von Schwerin gefangen und erst 1225 nach der Schlacht bei Mölln und Zahlung eines hohen Lösegelds freigelassen. Infolgedessen büßte Dänemark seine norddeutschen Territorien ein und gewann sie auch nach der Niederlage in der Schlacht von Bornhöved im Jahr 1227 nicht wieder.