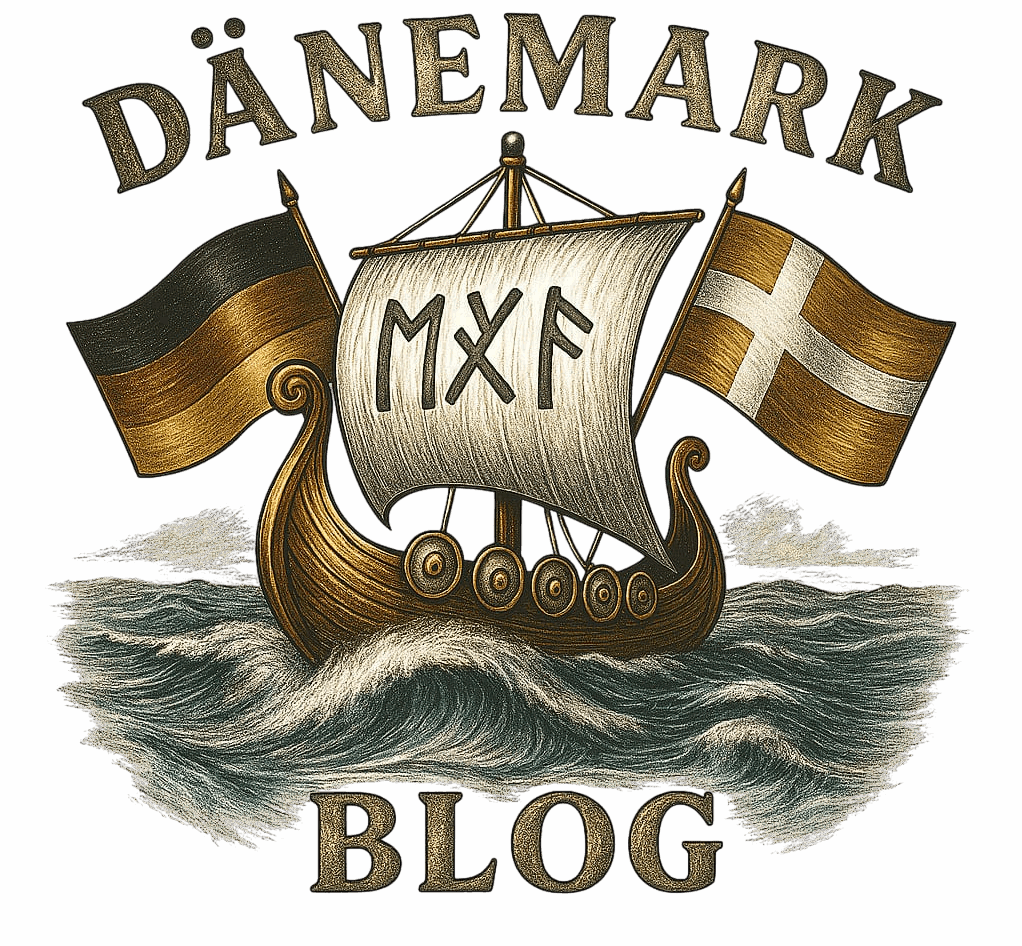Wikingerzeit
Christianisierung
Siedlungsgebiete im südlichen Jütland bzw. im heutigen Schleswig-Holstein zwischen etwa 800 und 1100
Skandinavische Ortsnamen im heutigen England
Um 700 versuchte der zum Missions-Erzbischof geweihte Willibrord vergeblich, den damaligen Dänenkönig Ongendus zu bekehren. Unter Karl dem Großen unterblieben weitere Missionsversuche, da er eine Missionierung nicht unterworfener Gebiete ablehnte. Dies hing mit seiner Idee von der Zusammengehörigkeit von Reich und Kirche zusammen und änderte sich erst unter Ludwig dem Frommen.
Unter Ludwig dem Frommen wurde auf Betreiben der Erzbischöfe Agobard von Lyon und Ebo von Reims die Mission über die Nordgrenze des Reiches wieder aufgenommen. Diesem Plan kam entgegen, dass der dänische Wikingerkönig Gudfred (Göttrik) 810 ermordet worden war. Dessen Söhne vertrieben den Kronprätendenten Harald Klak, worauf dieser Vasall König Ludwigs wurde. Mit dem Missionsauftrag des Kaisers reiste Ebo nach Rom, um den päpstlichen Missionsauftrag zu erhalten. Dieser Auftrag wurde 822 oder 823 mit einer Papstbulle von Papst Paschalis I. erteilt. Das Missionsgebiet wurde dabei nicht näher umschrieben (ubique).[30] Ebo unternahm 823 seine erste Missionsreise nach Dänemark. Der Papst schärfte ihm dabei ein, in allen Zweifelsfragen beim Papst rückzufragen, wie es schon für Bonifatius gegolten hatte. Damit begann sich der Missionsauftrag der Kirche allmählich von der Reichskirche zu emanzipieren. Mit dieser Bulle wurde Ebo Missionsvikar und Missionslegat des Papstes nach dem Vorbild des Bonifatius.
831 wurde auf einer Synode von Kaiser Ludwig das Erzbistum Hamburg errichtet. Der Erzbischof erhielt das Recht, im skandinavischen Bereich Bischöfe einzusetzen und Priester dorthin abzuordnen. Die politische Absicht dahinter war, den Norden der Reichskirche einzugliedern, was nur mit einem Erzbischofssitz im Reiche möglich war. Zum ersten Erzbischof wurde Ansgar von Erzbischof Drogo von Metz geweiht. 831/832 erhielt Ansgar das Pallium und eine Urkunde, in der ihm die Legation erteilt wurde. Gleichzeitig wurde die Errichtung des Missionserzbistums Hamburg bestätigt. Die Mission geriet aber nach der Plünderung Hamburgs durch die Dänen 845 ins Stocken, da alle Ressourcen vernichtet waren. 848[31] kam es dann zu der Gründung des Erzbistums Hamburg-Bremen durch eine Bulle Papst Nikolaus I. Ansgar trat zusammen mit den Gesandtschaften Ludwigs des Deutschen 843 und/oder 847 mit Horik I. von Dänemark in Verbindung. Dessen Taufe erreichte er zwar nicht, aber die Erlaubnis in Schleswig eine Kirche zu bauen. Horik geriet 850 in Thronstreitigkeiten mit seinen Neffen und fiel 854 in einem Bürgerkrieg und mit ihm alle Ansgar wohlgesinnten Berater. Von seiner Sippe blieb nur sein Neffe Horik II. übrig. Er stand anfangs unter dem Einfluss des mächtigen und christenfeindlichen Jarls Hovi von Schleswig. Horik II. entledigte sich aber bald seiner Ratgeber und wandte sich Ansgar zu, bat ihn um Priester, schenkte der Kirche in Ripen einen Bauplatz für eine Kirche und erlaubte die Anwesenheit eines Priesters. Auch Horik II. ließ sich nicht taufen, übersandte aber 864 Geschenke an Papst Nikolaus I. Während der Auseinandersetzungen um die Entstehung des Erzbistums Hamburg-Bremen mit dem Erzbischof von Köln gingen die Missionsversuche in Dänemark wieder zurück. Erst Erzbischof Unni von Hamburg (916-936) nahm sie wieder auf und schickte erneut Priester nach Dänemark. Dabei wurde er von Harald Blauzahn unterstützt. Dessen Vater, Gorm der Alte, hatte Dänemark geeint, war aber betont heidnisch eingestellt und zerstörte wahrscheinlich die Kirche in Schleswig.
Otto I. gründete 948 drei Bistümer in Dänemark: Schleswig, Ripen und Aarhus.[32] Das deutet darauf hin, dass zu dieser Zeit der Machtbereich Haralds auf Jütland beschränkt war. Im Laufe seiner Regierung hat er wohl, wie auf den Jellingsteinen berichtet, Fünen, Seeland, Schonen und die übrigen Inseln hinzugewonnen.[33]
Um 965 ließ sich Harald Blauzahn taufen. In den 980er Jahren kam noch Odense auf Fünen hinzu. 965 wurden alle dänischen Bistümer durch kaiserliches Privileg von den Abgaben an den Kaiser und dem Eingriffsrecht kaiserlicher Vögte befreit. Der Kaiser handelte hier als Herr und Schützer der Reichskirche für die Interessen des Bremer Erzbischofs Adalgar. Damit war der Hamburger Erzbischof die einzige Verbindung zwischen Dänemark und dem Reich. Dem dänischen König blieb die Ausstattung der dänischen Bistümer überlassen, die dänischen Bischöfe waren aber Suffragane des Hamburger Erzbischofs und damit Mitglieder der Reichskirche. Bald machten sich in den skandinavischen Kirchen auch unter Einfluss der englischen Kirche Bestrebungen bemerkbar, sich von der Reichskirche zu lösen. Mit Zunahme der Autorität des Papsttums begannen die Landeskirchen über die Reichsinstanzen hinweg unmittelbaren Kontakt mit dem Papst aufzunehmen. Für die Kurie war allerdings für eine auch von ihr gewünschte Verselbständigung der skandinavischen Kirchen unabdingbare Voraussetzung der Abschluss der Missionierung. Als Indikatoren wurde dafür angesehen: der Übertritt des Herrscherhauses und der führenden Schichten und des überwiegenden Teils des Volkes zum Christentum, außerdem eine wenigstens ansatzweise festzustellende Institutionalisierung kirchlichen Lebens durch Klöster und eine Diözesan- und Pfarrorganisation und zuletzt die nationale Unabhängigkeit und Fixierbarkeit des Territoriums.
Auf Dänemark angewandt ergab sich Folgendes: Harald Blauzahn ließ sich um 965 mitsamt seinem hirð, seiner Leibwache, taufen. Entscheidend dafür sei das Poppowunder gewesen. Sven Gabelbart ließ englische Missionare kommen. Er holte Bischof Gotebald aus England und entsandte ihn nach Schonen. Auch der dänische Klerus setzte sich mehr und mehr aus Einheimischen zusammen. Die dänische Kirche begann sogar selbst zu missionieren. Propst Oddar, ein Verwandter Sven Gabelbarts, erlitt bei der Missionierung der Elbslaven 1018 den Märtyrertod. Der Nachfolger von Sven Gabelbarts Sohn Harald II. war Knut der Große, welcher gegenüber der englischen Kirche eine offene Allianzpolitik betrieb.[34] Diese Politik geht auf Erzbischof Lyfing von Canterbury zurück, der wahrscheinlich den ersten Peterspfennig Knuts nach Rom brachte und dessen Anerkennung als König erwirkte. Papst Benedikt VIII. schrieb zum ersten Mal seit Papst Nikolaus I. einen Brief unmittelbar an einen Dänen. Die Bestrebungen, sich vom Hamburger Erzbistum zu lösen, kommen auch darin zum Ausdruck, dass Erzbischof Aethelnod von Canterbury drei Bischöfe für Dänemark weihte: Gerbrand für Roskilde, Bernhard für Schonen und Reginbert für Fünen. Damit wurde Lund von Roskilde abgetrennt und Knut geriet in Konflikt mit dem Hamburger Erzbischof Unwan (1013–1029). Dieser fing um 1022 Gerbrand auf seiner Reise von England nach Dänemark ab und überzeugte ihn von den Vorrechten des Erzbistums Hamburg über Dänemark. Es gelang ihm in der Folgezeit die Weiherechte für Dänemark zur Geltung zu bringen und Erzbischof Libentius II. (Libizo, Liäwizo) vom Erzbistum Bremen-Hamburg weihte 1029 Avoco zum Nachfolger Gerbrands in Roskilde. – Knut führte den Peterspfennig in Dänemark ein.
Frühmittelalter
Um 730 errichteten die Dänen zum Schutz gegen die südlich siedelnden Sachsen das Danewerk bei Haithabu in der Nähe von Schleswig. Etwa um 800 entführte ein lokaler dänischer König die internationale Kaufmannschaft aus dem damals slawischen Ort Reric (bei der Insel Poel) und siedelte sie stattdessen in Haithabu an.
Fast alle dänischen Dörfer stammen aus der Wikingerzeit bzw. sind älter als 800 Jahre. Dörfer mit dem Suffix -heim, ing(e), lev, løse und sted gehören zu den ältesten. Sie sind bereits aus der Zeit der Völkerwanderung bekannt. Suffixe mit torp und toft(e) sind vermutlich im 8. und 9. Jahrhundert aus England nach Dänemark gelangt, die auf -by aus Schweden. Die Suffixe -rød, rud, tved, holt, skov, have und løkke stehen für Rodungen, die im 13. Jahrhundert erfolgten.
Im Frühmittelalter wurden in den Quellen mehrmals Angriffe der Dänen auf andere Länder erwähnt. Um 884 fielen die Dänen in England ein, besetzten einen Teil des Landes, und forderten von den englischen Königen Tribut in Form des Danegelds. Im Jahre 924 hatte der englische König Eduard der Ältere das gesamte Danelag wieder unter englische Kontrolle gebracht.
Andererseits spielten sie eine bedeutende Rolle im Fernhandel, wie der 2012 entdeckte Münzschatz von Ibsker auf Bornholm belegt, der nach 854 vergraben wurde.
In den Jahrzehnten nach 900 stand Dänemark nicht unter einer einheitlichen Herrschaft, vielmehr gab es mindestens zwei, wenn nicht drei Machtzentren. Süderjütland mit der Handelsstadt Haithabu war in den Händen schwedischer Erobererkönige, die durch Adam von Bremen und zwei der Runensteine von Haithabu bekannt sind. Schweden saßen auf Lolland.[35] In Jelling südlichen Nördlichen Jütland hatte ein anderes Königsgeschlecht seinen Sitz, das nach Adam von Bremen um 900 aus Norwegen gekommen war. Unsicher ist, ob Håkon der Gute Seeland und die schonische Küste unterwarf.[36] Die schwedische Herrschaft in Haithabu wurde 934 von Heinrich dem Vogler besiegt. König Knut I. musste sich taufen lassen. Damit endeten die Wikingerzüge aus der Eidermündung auf friesisches Gebiet bis 980. Die dänischen Wikinger schienen sich stattdessen nach Osten gewandt zu haben; denn ein Runenstein aus dieser Zeit ehrt einen Krieger, der in Schweden umgekommen war.[37] Nach den Annalen von Corvey zum Jahre 934 hatte sich Heinrich „die Dänen“ unterworfen. Wie weit damit Jütland eingeschlossen ist, ist nicht festzustellen.
Überhaupt ist umstritten, was die Zeitgenossen unter Dänemark verstanden haben. Die Niederschrift Alfreds des Großen über die Fahrten Ottars und Wulfstans, das früheste Zeugnis dazu, bezeichnete als „Dänemark“ das heutige Südschweden einschließlich Schonen, die Inseln Falster, Lolland, Langeland und wahrscheinlich auch Seeland und die übrigen ostdänischen Inseln. Erst der nordjütische Skivum-Stein aus der Zeit des Jelling-Steins rechnete auch Nordjütland zu Dänemark, möglicherweise eine Folge der Einigung unter Harald Blauzahn. Unter diesem Gesichtspunkt sei auf dem Jellingstein berichtet, dass Harald Ostdänemark erobert habe.[38] Auf der anderen Seite bezeichnet Gregor von Tours, dass ein „dänischer“ König Chlochilaich Anfang des 6. Jahrhunderts in Gallien eingefallen sei.[39] Wenn aber die Vermutung richtig ist, dass Chlochilaich der Hygelac des Beowulf-Liedes ist, dann war er danach aus dem Stamm der Geaten, die mit Gauten und Goten in Verbindung gebracht wurden und irgendwo östlich von Jütland lokalisiert werden, was wieder mit Ottars Beobachtungen im Einklang stünde.
Dänemark wurde bereits vor 960 von Gorm (dem Alten) oder seinem Sohn Harald Blauzahn erstmals geeint. Die Königsgewalt war allerdings noch nicht weit entwickelt, von einer „Regierung“ in heutigem Sinne kann noch nicht gesprochen werden. Das zeigen auch die regellosen Wikingerzüge bis in die Regierungszeit Sven Gabelbarts hinein, die teilweise sogar Gebiete unter der Herrschaft des eigenen Königs betrafen. Bis weit in das 11. Jahrhundert wurden die Dänen als Wikinger bezeichnet, welche in ganz Europa Kolonien gründeten und Handel trieben, aber auch ganze Länder und Landstriche plünderten und Kriege führten. Um 1115 setzte der dänische König Niels Knud Lavard als Grenzjarl in Süderjütland ein. Aus dem Jarltum entstand später das Herzogtum Schleswig als dänisches Lehen.
Unter der Herrschaft Knuts des Großen erreichte Dänemark eine enorme territoriale Ausdehnung. So gehörten neben Dänemark auch Teile Schwedens, Norwegen und erneut England zum Reich Knuts des Großen. Nach Knuts Sohn Hardiknut übernahm Magnus der Gute von Norwegen die Herrschaft über Dänemark. Er musste aber bald dafür sterben und Knuts Neffe Sven Estridsson gelangte an die Macht.