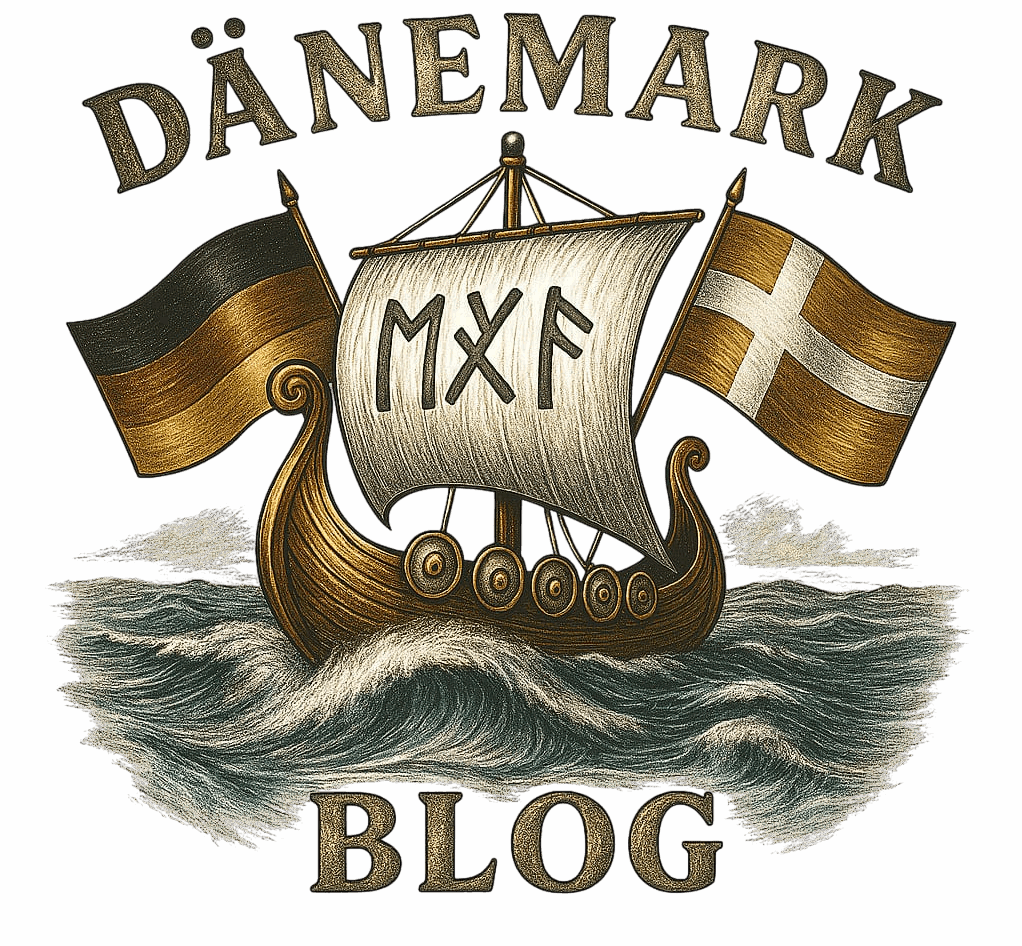Nachkriegszeit
Europäische Einigung
Nach 1945 forderten Stimmen in der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein eine Neuziehung der Grenzen zugunsten Dänemarks. Das Minderheitenproblem beiderseits der Grenze wurde in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen 1955 gelöst. siehe Hauptartikel: Deutsche Minderheit in Dänemark, Dänische Minderheit in Deutschland.
1945 war Dänemark Gründungsmitglied der UN, 1949 Gründungsmitglied der NATO, 1952 Gründungsmitglied im Nordischen Rat.
Nach einem Referendum am 2. Oktober 1972, bei dem 63,4 % der Wähler (mit einer Wahlbeteiligung von über 90 %) den EG-Beitritt befürworteten, wurde Dänemark am 1. Januar 1973 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft.
In einem Referendum wurde 1986 die Einheitliche Europäische Akte von 53 % der dänischen Wähler befürwortet. Die konservative Regierung unter Poul Schlüter, die die Unterzeichnung befürwortete, stand vor dem Problem, dass die Sozialdemokraten und Sozialliberalen die EEA mit einer Mehrheit des Parlaments ablehnten.
In einem Referendum über den Maastricht-Vertrag 1992 stimmten 50,3 % der Dänen mit Nein. Diese knappe Ablehnung brachte erstmals eine Verlangsamung in den Europäischen Einigungsprozess. Erst in einem weiteren Referendum am 18. Mai 1993, nachdem Dänemark in der Entscheidung von Edinburgh Konzessionen gemacht wurden, stimmten 56,8 % mit Ja, was die dänische Ratifizierung des Vertrags ermöglichte.[50] Proteste gegen die erneute Abstimmung führten zu Tumulten, bei denen 11 Personen mit Schusswaffenverletzungen behandelt werden mussten.
Bei einem Referendum über die Einführung des Euro entschied sich 2000 die Mehrheit der Dänen entgegen der Parlamentsmehrheit der etablierten Parteien für Nej (Nein). Bei einer Wahlbeteiligung von 87 % stimmten 53,2 % gegen den Beitritt zur Währungsunion.
Autonome Gebiete
Island war bereits seit 1918 weitgehend autonom (Realunion[47][48]) und ist bereits seit 1944 völlig unabhängig.
Die Färöer-Inseln genießen seit dem 31. März 1948 ein weitgehendes Selbstbestimmungsrecht, und lediglich die Außen- und Verteidigungspolitik verbleiben bei Dänemark. Der Vertrag von Fámjin vom 29. März 2005 hat diesen Status weiter ausgebaut und ergänzt.
Grönland, seit der Verfassungsänderung von 1953 keine Kolonie mehr, erhielt am 1. Mai 1979 die Selbstverwaltung und innere Autonomie. Nach einer Volksabstimmung vom 23. Februar 1982 trat Grönland am 1. Januar 1985 aus der Europäischen Gemeinschaft aus. Ein Abkommen vom 21. Juni 2009 hat den Unabhängigkeitsstatus weiter ausgebaut, insbesondere im Bereich Kultur und Innere Sicherheit. Nach wie vor ist die dänische Krone Staatsoberhaupt Grönlands.
Weiteres
Am 20. April 1947 starb König Christian X. Sein Sohn Friedrich folgte ihm auf dem Thron.
Mit einem positiven Referendum wurde 1953 eine Verfassungsänderung angenommen. Dabei wurde unter anderem das Zweikammersystem mit dem Oberhaus Landsting abgeschafft, das Folketing ist nunmehr die einzige Kammer im Parlament. Weitere Änderungen betrafen die Erbfolge des Königshauses (die Krone kann seither an Töchter vererbt werden), die Zuständigkeiten für Referenden, das Wahlalter (herabgesetzt auf 23) und Bürgerrechte.
In weiteren Referenden wurde das Alter für das allgemeine Wahlrecht von 23 weiter auf 21 (1961), 20 (1971) und schließlich 18 (1978) herabgesetzt. Ein Referendum von 1969, welches das Wahlalter bereits auf 18 reduzieren sollte, fand zu jenem Zeitpunkt keine Zustimmung.
Am 14. Januar 1972 starb König Friedrich IX. Seine Nachfolgerin wurde seine Tochter Margrethe – damit wurde erstmals die in der Verfassungsänderung von 1953 durchgesetzte neue Thronfolgeregelung angewendet.
In der Folketingswahl 1981 kam erstmals sei 1924 wieder eine konservative Mehrheit zustande, Poul Schlüter von der Konservativen Volkspartei löste Anker Jørgensen von der Socialdemokraterne als Regierungschef ab.
In den 1970er und 1980er Jahren beging die als Blekingegadebanden benannte Gruppe, eine linksextremistische Untergrundorganisation, durch Raubzüge in Dänemark und Schweden politisch motivierte Kriminalität, um die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) mit Geld zu unterstützen. Dabei kam es am 3. November 1988 zum schwersten Vorfall, bei dem auf einem Raubüberfall auf ein Kopenhagener Postamt ein Polizist erschossen wurde. Im April und Mai 1989 erfolgte die Festnahme der Gruppenmitglieder, die im Mai 1991 zum Teil zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden.
1989 führte Dänemark als erstes Land der Welt zivilrechtliche Partnerschaften für Homosexuelle ein.
Nach der Folketingswahl 1993 wurde der sozialdemokratische Poul Nyrup Rasmussen Ministerpräsident.
1998 wurde die Brücke über den Großen Belt eröffnet, im Jahr 2000 erfolgte die Einweihung der Öresundbrücke, welche die beiden durch den Öresund getrennten Wirtschaftszentren Dänemarks (Kopenhagen) und Südschwedens (Malmö) verbindet.
2001 wurde Anders Fogh Rasmussen von der rechtsliberalen Venstre-Partei Ministerpräsident. Als dieser 2009 als NATO-Generalsekretär berufen wurde, übernahm sein Parteifreund Lars Løkke Rasmussen seine Ämter.
Am 30. September 2005 veröffentlichte die dänische Tageszeitung Jyllands-Posten eine Serie von zwölf Karikaturen, die den islamischen Propheten und Religionsstifter Mohammed zum Thema haben. Die bildliche Darstellung des Gesichts Mohammeds ist im Islam nach verbreiteter Ansicht verboten und stellt in den Augen vieler Muslime eine Herabwürdigung des Propheten dar. Anfang 2006 erstellten die dänischen Imame Ahmad Abu Laban und Ahmed Akkari ein Dossier, in dem neben den originalen zwölf Karikaturen auch solche abgebildet waren, die nicht aus der Jyllands-Posten stammten und beleidigend-obszönen Inhalts waren, und die angeblich Abu Laban zugeschickt wurden. Unter anderem wurde ein betender Muslim dargestellt, der während des Gebetes von einem Hund bestiegen wurde. Daraufhin kam es zu weltweiten Protesten muslimischer Organisationen, die vom Boykott dänischer Produkte bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die mehr als 140 Menschenleben kosteten, reichten. Der Vorfall führte weltweit zu einer Diskussion über die Religions-, Presse-, Kunst- und Meinungsfreiheit. Der Begriff „Karikaturenstreit“ erreichte bei der Wahl zum Wort des Jahres 2006 den dritten Rang.
Im Jahr 2011 löste in Frankreich und Italien eine Welle von Asylsuchenden aus den Ländern der arabischen Revolutionsbewegung innenpolitische Debatten aus, die auch Dänemark erfassten. Unter dem Druck der an der Regierung beteiligten rechtspopulistischen Dansk Folkeparti verkündete die dänische Regierung im Mai 2011 eine Wiedereinführung von Kontrollen an den dänischen Grenzen unter Hinweis auf illegale Einreisen von Flüchtlingen und Kriminellen aus anderen EU-Ländern.[51] Diese Grenzkontrollen sollen jedoch nicht gegen das Schengener Abkommen verstoßen, da sie nur von Zöllnern durchgeführt würden.[52] In den europäischen Nachbarländern reagierte man auf diese Entscheidung vor allem mit Kritik. Eine Reformierung des Schengener Abkommens wurde durch die Debatte angestoßen.