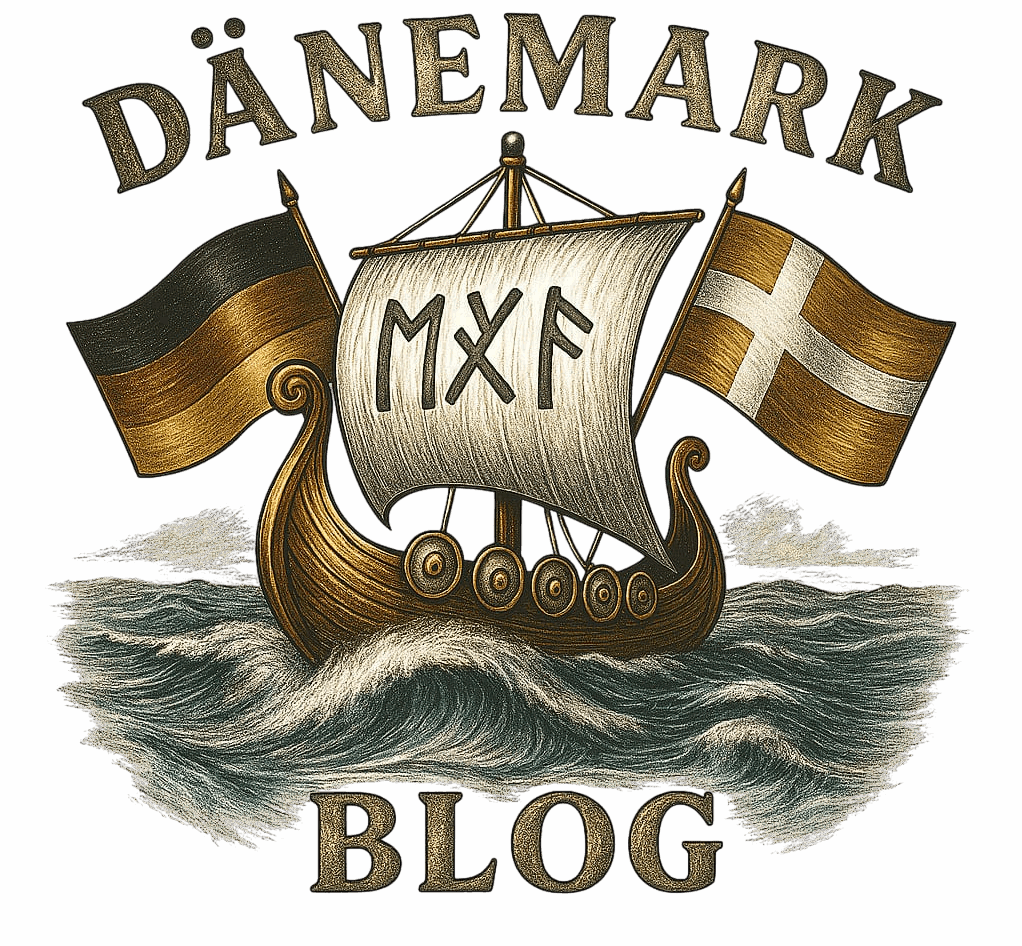Urgeschichte
Geschichte der urgeschichtlichen Archäologie in Dänemark
Fundplatz Dværgebakke, 2005
Als einer der Begründer der Archäologie Skandinaviens gilt Ole Worm. 1626 veranlasste er König Christian IV., alle Pfarrer aufzufordern, Runensteine, Gräber und sonstige Altertümer in ihrem Sprengel zu melden. Er griff wiederum auf den Altertumsforscher Nicolaus Marschalk († 1525) zurück, der als einer der ersten in Mecklenburg Grabhügel öffnete. 1643 veröffentlichte Worm ein Überblickswerk über die Monumente Dänemarks,[1] auch sammelte er Altertümer in seinem Museum Wormianum.[2]
Das antiquarische Interesse richtete sich bereits im 17. Jahrhundert auf Artefakte der Vorzeit, wie das 1639 entdeckte erste der beiden Goldhörner von Gallehus, deren zweites 1734 entdeckt wurde. 1797 entdeckte man die Luren von Brudevælte. Rasmus Nyerup (1759–1829) begann seiner Auffassung nach vorchristliche Artefakte zu sammeln, saß in der 1807 gegründeten Königlichen Antiquitätenkommission, scheiterte jedoch daran, diese in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen. Doch auf seine Sammlung geht das 1807 bzw. 1819 gegründete Nationalmuseum in Kopenhagen zurück, und er setzte den Numismatiker Christian Jürgensen Thomsen als Leiter ein, der die Funde zeitlich ordnen sollte.
Auf diesen wiederum geht das 1816 der Öffentlichkeit durch das Ausstellungskonzept im Museum vorgestellte Dreiperiodensystem zurück, das die Urgeschichte bis heute in die drei Perioden Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit gliedert.[3] 1835 wurde mit der Frau von Haraldskær eine erste Moorleiche gefunden (der älteste, der 1941 entdeckte Mann von Koelbjerg, ist über 9000 Jahre alt[4]); Thomsen führte 1845 eine archäologische Grabung in Hvidegaard nördlich von Kopenhagen durch, wo man ein bronzezeitliches Kriegergrab entdeckt hatte. Als erste wissenschaftliche Überblicksdarstellung der dänischen Urgeschichte gilt Jens Jacob Asmussen Worsaaes Danmarks oldtyd oplyst,[5] das 1843 erschien und 1849 ins Englische übersetzt wurde.[6] Worsaae unterschied erstmals zwischen Jungsteinzeit und Altsteinzeit, zugleich trug es erheblich zur Durchsetzung des Dreiperiodensystems im Laufe der 1850er Jahre bei. Worsaae datierte die Erstbesiedlung Dänemarks auf etwa 3000 v. Chr.[7] 1865 barg das Nationalmuseum bereits 27.000 Artefakte.[8] Doch der Einfluss der Gründer der dänischen Archäologie führte in den folgenden Jahrzehnten dazu, dass die Wissenschaftler sich überwiegend mit Klassifizierung, Datierung und archäologischen Kulturen befassten, weniger mit den dahinter liegenden Gesellschaften. Erst durch angelsächsische Arbeiten richtete sich der Fokus wieder auf die urgeschichtlichen Gesellschaften und ihre Lebensweise,[9] was durch aufsehenerregende Funde, wie den um 7500 v. Chr. erlegten Auerochsen von Vig (1904), das Hjortspringboot (1921), die sehr gut erhaltenen eisenzeitlichen Männer von Tollund (1950) und Grauballe (1952) oder verschiedene Frauenleichen, wie die Frau von Elling (1938) gefördert wurde.
Johannes Brøndsted, Direktor des Kopenhagener Museums von 1951 bis 1960, förderte neue Methoden, verstärkte den Schutz von Fundstätten und die Popularisierung der Archäologie; letzteres förderte vor allem sein Nachfolger Peter Vilhelm Glob (1960-81). Sein dreibändiges Werk Danmarks Oldtid, erschienen 1938 bis 1941, gilt als Meilenstein.[10] 1941 und 1950 entstanden in Kopenhagen und Aarhus universitäre Institute für Archäologie, das Radiokohlenstofflabor am Nationalmuseum war eines der ersten in Europa. Parallel dazu wuchs die Zahl der Fundstätten ungemein an. So verzeichnete man 2016 in Dänemark und Schleswig-Holstein allein 2735 Bestattungen aus der Bronzezeit.[11] Seit 2012 wird die Archäologie Dänemarks von der dem Kulturministerium unterstellten Zentralagentur Kulturstyrelsen betrieben; dabei sind die Regionalmuseen für die Ressourcen in ihrem Verantwortungsbereich eigenständig tätig.[12]
Altsteinzeit
Jungpaläolithikum (ab 13. Jahrtausend v. Chr.)
Gegen Ende der letzten Eiszeit folgten Jäger den großen Rentierherden, die im Sommer in die nördlichen Tundrengebiete, im Winter in die südlicheren Gebiete wanderten. Die Tiere wurden von den Jägern mit Speeren, die mittels Speerschleuder geworfen wurden, erlegt. Wichtige Fundstätten der Hamburger Kultur (13.700–12.200 v. Chr.), der diese Jäger zugeordnet werden, sind innerhalb Dänemarks Jels, wo 1981 zum ersten Mal Funde dieser Kultur in Dänemark zu Tage traten, und Slotseng (ab 1990 ergraben) im Ostteil des südlichen Jütland,[13] dann Sjølberg im Süden Lollands. Hinzu kommen Geweihfunde aus der Køge Bugt, die zu dieser Zeit am Rande des einstigen Baltischen Sees lag. Die dortigen bearbeiteten Geweihe wurden auf 12.140 v. Chr. datiert.[14] Zu dieser Zeit reichte die Küstenlinie wegen der Meerwasserbindung im Gletschereis der Weichseleiszeit auf der Nordseeseite bis zur Doggerbank. Die Fundstätten liegen meist an Stellen, an denen die Rentierherden vorbeizogen, deren ungefähre Wanderrouten sich rekonstruieren ließen. Dabei ist Jels II der größte Fundplatz der Hamburger Kultur im Norden Europas. Vermutlich stand dort ein Zelt, das womöglich über längere Zeit bewohnt war, denn in der Umgebung fanden sich über 700 retuschierte Werkzeuge. Im nahegelegenen Slotseng C fand man etwa 200 Werkzeuge; mit 12.500 v. Chr. stellt es eine der ältesten jungpaläolithischen Fundstätten des Nordens dar. 2006 kam zu den bekannten Fundstätten noch Krogsbølle bei Nabskov auf Lolland hinzu, 2009 fand man bei Jels einen zweiten Lagerplatz, der Nedersøparken genannt wird.[15] Wahrscheinlich hielten sich die wenigen Jägergruppen nur in der wärmeren Jahreszeit so weit im Norden auf; dabei waren die heute in der Nordsee versunkenen Gebiete ein wichtiger Teil ihres Schweifgebietes, wie Funde in Schottland belegen. In der nachfolgenden Kaltphase, dem älteren Dryas (11.590–11.400 v. Chr.), kam es wahrscheinlich zu einer Abwanderung in den Süden.
Die späteiszeitliche, dann aber dauerhafte Besiedlung Dänemarks, das bei 100 m tieferem Meeresspiegel eine weitaus größere Fläche in der Nord- und Ostsee bedeckte, begann mit der Bromme-Kultur (11.500–10.000 v. Chr.[16]), deren Vertreter in der Tundra Elch, Moschusochse, Pferd und Rentier jagten. Sie ist nach einem Fundort bei Sorø auf Seeland benannt. Als 1889 erstmals ein Artefakt dieser Kultur entdeckt wurde, hieß die Kultur zunächst Lingby-Kultur, spätestens ab 1944 jedoch wurde sie nach dem Fundort Bromme auf Seeland benannt. Der Wasserspiegel der Ostsee, die ein Süßwasserbecken war, lag 50 m höher als der der Nordsee, der 100 m tiefer als heute lag. Die vermutlich nur saisonalen Aufenthalte der Brommeleute an den Wohnplätzen hinterließen vor allem Werkzeuge. Ihre Lager finden sich besonders an den Seen und Flüssen (auf Djursland und bei Langå). Da sich bisher an den über 100 Fundstätten in Norddeutschland und Skandinavien nur große Bromme-Spitzen fanden, scheinen Pfeil und Bogen nicht in Gebrauch gewesen zu sein; die Bearbeitungstechnik war im Vergleich zur Hamburger Kultur recht einfach. Anscheinend bestanden aber dauerhafter bewohnte Lager, die etwa 50 m² groß waren und eine zentrale Feuerstelle aufwiesen. Der Zusammenhang zur Federmesser-Kultur und zur Hamburger Kultur wird seit langem diskutiert.
Die Ahrensburger Kultur setzte zwar um 11.000 v. Chr. ein, doch die Mehrheit der Funde stammt aus der Zeit zwischen 10.100 und 9400 v. Chr.[17] Die Artefakte dieses Hamburgien umspannen den Raum zwischen England und Schweden sowie erhebliche Teile der Tiefebenen Nordeuropas. Die rund 1500 Jahre nach der Hamburger Kultur liegende Epoche weist zwar Ähnlichkeiten auf, doch gibt es keine Belege für eine Kontinuität. Ihre Projektilspitzen waren klein, manchmal erscheinen dort kleine Bromme-Spitzen, dazu sogenannte Zonhoven-Spitzen. Ahrensburger Fundplätze sind in Dänemark selten. Wichtigster Platz ist Dværgebakke.
Mesolithikum (etwa 9700/9300 bis 4000 v. Chr.)
Die Zeit zwischen dem Ende der letzten Eiszeit und der einsetzenden produzierenden Lebensweise wird üblicherweise auf 9700 bis 4000 v. Chr. datiert und als Mesolithikum bezeichnet. Dabei setzte das Mesolithikums Dänemarks erst relativ spät ein. Eine der Ursachen könnte sein, dass sich die Wälder erst langsam nordwärts ausbreiteten und noch lange Graslandschaften dominierten, wie Funde in Lundby Mose auf Seeland nahelegen, dem ältesten mesolithischen Fundplatz des Landes (ca. 9300 v. Chr.).[18]
Das Mesolithikum wird in Dänemark üblicherweise in vier archäologische Kulturen eingeteilt, deren zweite die Maglemose-Kultur (7400–6000 v. Chr.) ist. Sie wurde zunächst nach dem großen Moor bei Mullerup (Seeland) auch als Mollerup-Kultur bezeichnet,[19] und ist außer im späteren Nordkreis auch in England (Boxburne, Star Carr) und in Nordrussland (dort als Kunda-Kultur bezeichnet) bis jenseits des Urals verbreitet. Maglemose bedeutet ‚Großes Moor‘. Der südlichste Fundplatz ist Haltern am See in Nordrhein-Westfalen. In der Maglemose-Kultur bildeten sich wegen der weiten Verbreitung und der Langlebigkeit der Kultur, aber auch wegen klimatischer Veränderungen und Einflüssen der Nachbarkulturen Gruppen heraus, auch wurde England um 6800 v. Chr. durch eine Flut vom Festland abgeschnitten. Im Maglemosien breiteten sich die Wälder in weiten Teilen Dänemarks aus, was die Lebensweise drastisch veränderte. Wichtige Fundstätten sind Holmegård, Ulkestrup, Lying, Öregarde, Sværdborg[20] und Kongemose. Ihre Artefakte haben sich ungewöhnlich gut erhalten, da die meisten Siedlungen im Moor lagen. Zu diesen zählen etwa bis 1,8 m hohe Bögen aus Ulmenholz, Bolzenpfeile aus Kiefernholz, aber auch zahlreiche Artefakte aus Knochen und Geweih. Die rechteckigen oder trapezförmigen, 2,5 bis 4,5 mal 2,5 bis 6 m messenden Hütten hatten Böden aus geflochtenen Rindenstreifen und gespaltenen Birken- und Kiefernstämmen. Es fanden sich Ritzungen auf Geweih und Knochen, Tierplastiken aus Bernstein (Singaalgard auf Seeland), durchbohrte, durch Strichmuster verzierte Schmuckscheiben. Eine Vorstufe zur Keramik ließ sich anhand luftgetrockneter, ungemagerter und ungebrannter Scherben nachweisen.
Die Kongemose-Kultur (6000–5200 v. Chr.)[21] wurde ebenfalls nach einem Moor auf Seeland benannt und tritt gleichfalls in Gruppen auf (Gudenå und Ahrensburg, das den Ursprung zu bilden scheint). Die Jagd auf Rotwild und Wildschweine wurde wesentlich durch Beeren, Fische, Nüsse, Schalentiere, Vögel und Wurzeln ergänzt.
Die letzte mesolithische Kultur, die Ertebølle-Kultur, wird im deutschsprachigen Raum auch Ertebølle-Ellerbek-Kultur genannt. Sie wird auf 5500–4000 v. Chr. datiert.[22] Sie wurde nach Fundplätzen auf der Kimbrischen Halbinsel benannt. Es handelte sich um eine Kultur, deren Basis die Fischerei war, dazu andere marine Lebewesen, wie Muscheln. Zunächst nur an den Muschelhaufen, die die Kultur hinterlassen hat, untersucht (Brovst am Limfjord, auf 5700 v. Chr. datiert, ist der älteste), hielt man die Bewohner für Gruppen, die am Existenzminimum lebten, und durch die Landwirtschaft schließlich von ihrer rückständigen Lebensform „erlöst“ wurden, zumal man glaubte, sie lebten unmittelbar auf den Abfallhaufen. Zudem stimmten die dänischen Wissenschaftler dieser Deutung zu, da sie von der französischen Forschung inspiriert waren, die im 19. Jahrhundert das Mesolithikum für eine Degenerationszeit hielt, in der die großen Jägerkulturen untergegangen waren. Jedoch sind inzwischen äußerst langlebige Kontakte zwischen den Mesolithikern und den bäuerlichen Kulturen des Südens, den Neolithikern belegt, ebenso wie ein mehrere Jahrtausende währendes Nebeneinander der Lebensweisen. So fand man Artefakte der bäuerlichen Rössener Kultur an Ertebølle-Fundplätzen. Offenbar bot die vergleichsweise ortsfeste Lebensweise der Mesolithiker im Ostseeraum Dänemarks ähnlich sichere Lebensgrundlagen, wie die der Neolithiker weiter im Süden.[23] Erst um 4000 v. Chr. setzte sich die bäuerliche, produzierende Lebensweise gegen die aneignende der Mesolithiker durch. Während dieser Übergang offenbar vergleichsweise wenig gewalttätig war, scheint sowohl in Schweden als auch in Dänemark der Übergang „Kongemose/Ertebølle eine Zeitspanne erhöhten Gewaltaufkommens“ darzustellen.[24]
Neolithikum (etwa 4000 bis 1700 v. Chr.)
Die Jungsteinzeit in Dänemark begann um 4000 v. Chr. und dauerte bis 1700 v. Chr. Die Periode bekam auch den Namen „Bondestenalter“ (Bauernsteinzeit), weil die Menschen das Land kultivierten und Vieh hielten. Es fand eine Zuwanderung aus dem Süden statt, wo die Menschen schon lange Bauern waren.
Bronzezeit
Die Bronzezeit begann in Dänemark etwa 1600 v. Chr. und dauerte bis 500 v. Chr.
Eisenzeit
Die Eisenzeit wird unterteilt in die vorrömische Eisenzeit, die römische Eisenzeit und die germanische Eisenzeit[25]. Sie dauerte von 500 v. Chr. bis 800 n. Chr.[26]
In der frühen vorrömischen Eisenzeit war der Hof das Grundelement der Siedlungen. Dennoch muss es auch übergreifende Strukturen gegeben haben, wie der Fund von 60 toten Kämpfern bei Hjortspring belegt. Eine solche Zahl erforderte die Kooperation zahlreicher Höfe oder mehrerer Siedlungen. In der späten vorrömischen Zeit ist die soziale Differenzierung anhand der Hausgrößen deutlich zu erkennen, wie in Hodde, wo sich ein umzäunter sehr viel größerer Hof in der Siedlung fand. Auch fanden sich reiche ausgestattete Gräber, wie in Langå in Fünens Osten.[27]
113 v. Chr. wurden die in und südlich von Jütland siedelnden Kimbern und Teutonen erstmals erwähnt. Vom 2. bis 6. Jahrhundert finden sich Spuren eines Vorläufers einer Großsiedlung mit zentralem Charakter und weitreichenden Handelsbeziehungen im Osten von Fünen bei Gudme. Während der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts tauchen plötzlich in gotischen, fränkischen und byzantinischen Quellen Hinweise auf die Existenz und die kriegerischen Taten von Dänen auf.[28] Dazu gehört auch die Schilderung Prokops über die Wanderungen der Heruler vom Donauraum nach Norden. Als eines der Völker, dessen Gebiet sie berührten, werden die Danoi genannt. Jordanes schreibt in seiner Gotengeschichte von Konflikten zwischen Dänen und Herulern. Dabei meint er, dass die Dänen von den Suionen (Schweden) abstammten. Gregor von Tours bezeichnet den König Chlochilaicus als „Dänenkönig“. Der Dichter Venantius Fortunatus feiert in seinen Preisgedichten auf die Frankenkönige Chlothar I. und Chilperich deren Siege über die Dänen. Ganz überwiegend wird die Urheimat der Dänen im heutigen Südschweden, besonders in den bis 1658 zu Dänemark gehörenden Gebieten Schonen und Halland, vermutet.